Alle zentralen Begriffe rund um Branding, Kommunikation und Nachhaltigkeit bzw. Nachhaltigkeitsmanagement.
NACHHALTIGKEIT
A
Ein international anerkannter Standard für die strukturierte und glaubwürdige Einbindung von Stakeholdern. Er bietet Organisationen einen praxisorientierten Rahmen, um Stakeholder-Dialoge strategisch zu planen, umzusetzen, zu bewerten und kontinuierlich zu verbessern. Dabei stehen Transparenz, Rechenschaftspflicht und die kontinuierliche Verbesserung der Beziehungen zu Anspruchsgruppen im Mittelpunkt. Der Standard stammt vom gemeinnützigen Netzwerk AccountAbility (externer Link).
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wurde 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet und bildet den globalen Rahmen für die 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Alle Länder – ob Industrie-, Schwellen- oder Entwicklungsländer – sind gleichermaßen aufgerufen, diese Ziele umzusetzen. Die Agenda 2030 adressiert u. a. Themen wie Armutsbekämpfung, Bildung, Gesundheit, Geschlechtergerechtigkeit, Klimaschutz und globale Partnerschaften. Im Kontext des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) spielt sie eine wichtige Rolle, da Unternehmen ihre Ziele und Maßnahmen an den SDGs ausrichten können.
Weitere Informationen: Vereinte Nationen – Agenda 2030 (externer Link)
Barrierefreiheit bedeutet, dass alle Lebensbereiche – von Gebäuden und Verkehrsmitteln bis hin zu digitalen Angeboten – so gestaltet werden, dass sie von allen Menschen ohne fremde Hilfe und ohne Einschränkungen genutzt werden können. Dazu gehört neben der physischen Zugänglichkeit (z. B. rollstuhlgerechte Zugänge oder visuelle Kennzeichnungen) auch die digitale Barrierefreiheit (z. B. barrierearme Webseiten). Für Unternehmen ist Barrierefreiheit auch in der Kommunikation und im Arbeitsalltag essenziell, um Inklusion zu fördern und Chancen für alle zu schaffen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (externer Link).
B
Ein strategisches Instrument, bei dem die eigene Leistung mit ausgewählten Referenzwerten („Best Practices“) verglichen wird, um Verbesserungsziele abzuleiten. Im Nachhaltigkeitskontext hilft Benchmarking dabei, ESG-Leistungen oder Umweltauswirkungen mit vergleichbaren Unternehmen zu messen und zu verbessern.
Betriebliche Nachhaltigkeit beschreibt die ganzheitliche nachhaltige Entwicklung innerhalb eines Unternehmens. Sie umfasst neben der wirtschaftlichen Stabilität auch ökologische und soziale Aspekte. Im Unterschied zur nachhaltigen Entwicklung einer gesamten Gesellschaft oder Branche ist hier speziell die interne Perspektive des Unternehmens gemeint: Ziele, Prozesse und Maßnahmen, um Ressourcen zu schonen, Mitarbeitende fair zu behandeln und langfristig erfolgreich am Markt zu bestehen.
Die Biosphäre umfasst alle von Lebewesen bewohnten Bereiche der Erde und bildet mit Atmosphäre, Hydrosphäre und Lithosphäre ein dynamisches Gesamtsystem. Sie ermöglicht essenzielle biologische Prozesse wie Photosynthese, Kompostierung und Zersetzung, welche die Grundlage natürlicher Stoffkreisläufe bilden.
Im Kontext der Kreislaufwirtschaft spielt die Biosphäre eine zentrale Rolle, indem sie umweltfreundliche Materialien aufnimmt, umwandelt und in biologischen Kreisläufen zirkulieren lässt. Damit werden wertvolle Ökosystemdienstleistungen – zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit und Bestäubung – erhalten und die Wiederverwertung von Ressourcen unterstützt.
Bluewashing bezeichnet das betonte Hervorheben eines vermeintlichen Engagements für Arbeits- und Menschenrechte oder eine bewusst täuschende Kommunikationsstrategie – häufig unter Berufung auf die Symbolik der UN – , ohne wirklich wirksame oder überprüfbare Maßnahmen zu ergreifen. Dabei verweisen Unternehmen oder Organisationen oft auf internationale Abkommen oder UN-Initiativen, ohne die versprochenen Standards jedoch tatsächlich in ihren Prozessen und Geschäftspraktiken umzusetzen oder zu überwachen.
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) zielt darauf ab, Menschen zu befähigen, die Welt im Sinne der Nachhaltigkeit aktiv mitzugestalten. Sie fördert kritisches Denken, Zukunftskompetenz und wertebasiertes Handeln und vermittelt das nötige Wissen, um ökologische, soziale und ökonomische Herausforderungen verantwortlich zu begegnen. BNE kann in Schulen, Hochschulen, Kitas, Weiterbildungseinrichtungen oder gemeinnützigen Projekten verankert werden.
C
Das Carbon Disclosure Project (CDP) ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die Unternehmen, Städte und Regionen zur freiwilligen Offenlegung ihrer Treibhausgasemissionen und anderer Umweltdaten auffordert. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und Investoren, Unternehmen und Regierungen fundierte Informationen über Klimarisiken und Umweltperformance bereitzustellen.
Das CDP gilt als eines der weltweit führenden Systeme zur Offenlegung klimabezogener Daten.
Weiterführende Informationen: Offizielle CDP-Webseite (externer Link)
Eine Maßeinheit zur Vergleichbarkeit der Klimawirkung verschiedener Treibhausgase. Gase wie Methan oder Lachgas werden in Bezug auf ihren Beitrag zur Erderwärmung in CO2-Äquivalente umgerechnet.
CO2-Äquivalente ermöglichen eine konsistente Bilanzierung von Emissionen – etwa im GHG Protocol.
Carbon Insetting bezeichnet Klimaschutzmaßnahmen, die Unternehmen innerhalb ihrer eigenen Wertschöpfungskette umsetzen – etwa um CO2-Emissionen bei Zulieferern oder Produktionspartnern zu reduzieren oder zu binden. Ziel ist, Treibhausgasemissionen innerhalb des eigenen Einflussbereichs zu verringern. Voraussetzung ist eine transparente, standardbasierte Klimabilanz (siehe Corporate Carbon Footprint).
Insetting stärkt Klimaengagement im eigenen Einflussbereich und kann integraler Bestandteil einer glaubwürdigen Klimastrategie sein.
Bezeichnet den Zustand, in dem sämtliche Treibhausgasemissionen eines Produkts, einer Organisation oder Veranstaltung vollständig ausgeglichen werden, sodass in der Bilanz keine weiteren Emissionen anfallen. Dies erfolgt durch Vermeidung, Reduktion und – zuletzt – Kompensation von Emissionen.
Klimaneutralität ist ein zentrales Ziel vieler Klimastrategien, steht aber auch in der Kritik, wenn Reduktion hauptsächlich durch Kompensation erreicht wird.
Beim Carbon Offsetting (dt. „CO2-Kompensation“) werden Maßnahmen oder Projekte – meist außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette – zur Reduktion, Vermeidung oder Bindung von Treibhausgasemissionen finanziert, um die nicht vermeidbaren Emissionen eines Unternehmens oder einer Person auszugleichen. Grundlage ist der Erwerb von CO2-Zertifikaten, die eine Tonne vermiedene oder gebundene Emissionen belegen.
Es gibt verschiedene Formen, z. B. Negative Emissions (Carbon Removal) und Carbon Avoidance. Carbon Offsetting kann eine sinnvolle Ergänzung zur Emissionsvermeidung sein – setzt aber eine glaubwürdige Klimabilanz und hohe Qualitätsstandards voraus.
(Der Begriff „CO2-Kompensation“ wird synonym verwendet. In technischen oder internationalen Kontexten wird meist „Carbon Offsetting“ genutzt.)
Chancengerechtigkeit bezeichnet faire und gleiche Möglichkeiten für alle Menschen – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Behinderung oder Lebensumständen. In Organisationen zeigt sich Chancengerechtigkeit u. a. durch transparente Rekrutierungsprozesse, faire Vergütung, lexible Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder barrierefreie Arbeitsplätze.
Chancengerechtigkeit ist ein zentraler Bestandteil sozialer Nachhaltigkeit und fördert Diversität, Innovation und Zufriedenheit im Arbeitsumfeld.
Die „Charta der Vielfalt“ ist eine freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen und Institutionen in Deutschland, sich für ein vorurteilsfreies, inklusives und wertschätzendes Arbeitsumfeld einzusetzen. Unterzeichnende bekennen sich zur Vielfalt der Belegschaft – unabhängig von Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht, Behinderung oder sexueller Identität.
Die Charta der Vielfalt (externer Link) ist ein starkes öffentliches Bekenntnis zu Diversität und eine Plattform für Austausch und Best Practices.
Circular Economy (dt. „Kreislaufwirtschaft“) bezeichnet ein Wirtschaftsmodell, das Produkte, Materialien und Ressourcen möglichst lange im Umlauf hält. Statt linearer Nutzung mit anschließender Entsorgung stehen Wiederverwendung, Reparatur, Aufbereitung und Recycling im Vordergrund.
Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft reduziert Abfall, schont Ressourcen und ist ein Schlüssel zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse. Ziel ist, die Material- und Energieeffizienz zu steigern und negative Umweltauswirkungen zu verringern.
Ein Mechanismus des Kyoto-Protokolls, der es Industrieländern ermöglicht, Emissionsminderungsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern durchzuführen. CDM soll den Technologietransfer und klimafreundliche Investitionen in Ländern des Globalen Südens fördern.
Im Gegenzug erhalten sie Emissionsminderungszertifikate (CER), die auf ihre nationalen Kyoto-Emissionsziele angerechnet werden können. So sollen klimafreundliche Investitionen in Entwicklungsregionen gefördert werden.
CO2-Emissionsketten beschreiben, an welchen Stellen in der Wertschöpfungskette eines Produkts oder Unternehmens CO2-Emissionen entstehen – von der Rohstoffgewinnung über Produktion und Nutzung bis zur Entsorgung. Sie umfassen sowohl direkte Emissionen (Scope 1) als auch Emissionen in vor- und nachgelagerten Prozessen (Scope 2 und 3).
Eine detaillierte Kenntnis dieser Ketten ist Voraussetzung für effektive Klimastrategien (siehe Klimastrategie).
Der CO2-Fußabdruck (engl.: Carbon Footprint) misst die Gesamtheit der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen, die durch menschliche, industrielle oder unternehmerische Aktivitäten verursacht werden. Grundlage sind in der Regel die Scopes 1, 2 und 3 gemäß GHG Protocol.
Der CO2-Fußabdruck ist ein zentraler Indikator zur Bewertung von Klimawirkung und zur Steuerung von Reduktionszielen.
Der CO2-Handabdruck (engl.: „Carbon Handprint“) ist ein Konzept zur Darstellung positiver Klimawirkung: Der CO2-Handabdruck ergänzt den CO2-Fußabdruck zeigt, wie Aktivitäten, Produkte oder Innovationen zur Emissionsvermeidung beitragen – etwa durch Effizienzsteigerung oder neue Lösungen.
Er ergänzt den CO2-Fußabdruck um eine positive Perspektive und fördert Innovationen und Selbstwirksamkeit Verhalten.
Der CO2-Handel (engl.: Emissions Trading) ist ein marktbasiertes Instrument zur Reduktion von Emissionen. Unternehmen erhalten oder erwerben Zertifikate (Emissionsrechten) für eine bestimmte Menge CO2 oder oder CO2-Äquivalente, die sie ausstoßen dürfen. Nicht genutzte Rechte können gehandelt werden (Cap-and-Trade-System).
Durch den Handel mit diesen Zertifikaten entsteht ein Markt, der Emissionen dort reduziert, wo es am kostengünstigsten ist (vgl. Emission Trading Scheme (ETS)). CO2-Handel hat das Ziel so finanzielle Anreize zur Emissionsreduktion zu schaffen und ist ein zentrales Element europäischer Klimapolitik.
Ein CO2-Zertifikat (engl. Carbon Credit) entspricht dem Recht, eine Tonne CO2 oder eine äquivalente Menge anderer Treibhausgase zu emittieren oder zu kompensieren. Diese handelbaren Einheiten sind ein zentrales Instrument der Emissionshandelssysteme und (freiwilligen) Kompensationsmaßnahmen (Carbon Offsetting) und können z. B. aus Projekten zur Aufforstung, zum Ausbau erneuerbarer Energien oder zur Energieeffizienzsteigerung hervorgehen.
Der Code of Conduct ist ein interner Verhaltenskodex für regel- und wertekonformes Verhalten in Unternehmen, den sich diese selbst auferlegen bzw. akzeptieren, um rechts- und regelkonformes Handeln zu fördern. Er enthält z. B. Richtlinien zu Antikorruption, Gleichbehandlung oder Umweltschutz und sollte durch Schulungen, Kommunikation und Sanktionen begleitet werden.
Ein Code of Conduct sollte unternehmensspezifische Besonderheiten berücksichtigen und von allen Mitarbeitenden gelebt werden. Flankierend sind Schulungen, klare Kommunikationswege und Sanktionsmechanismen notwendig.
Ein wirksamer Verhaltenskodex stärkt Integrität, Rechtskonformität und Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag.
Das Comply-or-Explain-Prinzip ist ein regulatorischer Ansatz, bei dem Unternehmen zu bestimmten Themen berichten (comply) oder begründen müssen, warum sie dies (noch) nicht tun (explain). Anwendung z. B. im Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) oder bei den ESRS.
Das Prinzip fördert Transparenz und motiviert zur kontinuierlichen Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit.
Corporate Carbon Footprint (dt. „betrieblicher CO2-Fußabdruck“) bezeichnet die gesamte CO2-Bilanz eines Unternehmens. Dazu zählen direkte Emissionen (Scope 1) sowie indirekte Emissionen aus Energiebezug (Scope 2) und der Liefer- bzw. Nutzungskette (Scope 3).
Warum ist das relevant?
Der Corporate Carbon Footprint ist Ausgangspunkt für die Entwicklung einer fundierte Klimastrategie.
Corporate Citizenship (CC) bezeichnet das freiwillige gesellschaftliches Engagement von Unternehmen über ihre eigentliche Geschäftstätigkeit hinaus – z. B. durch Spenden, Sponsoring oder Stiftungen. Es ist somit ein Teilaspekt der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen und unterscheidet sich vom umfassenderen Begriff CSR.
Corporate Citizenship stärkt die lokale Gemeinschaft und das soziale Profil eines Unternehmens.
Corporate Social Initiatives sind marketingorientierte Maßnahmen, die auf die Darstellung unternehmerischer Verantwortung – z. B. durch Kampagnen oder Spendenaktionen – und ein positives Unternehmensimage abzielen. Sie sind Bestandteil der Kommunikation im Rahmen von CSR.
CSI stärken das öffentliche Image und können zu mehr gesellschaftlichem Engagement motivieren – müssen aber glaubwürdig sein.
Corporate Social Responsibility bezeichnet die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, freiwillig über gesetzliche Anforderungen hinaus sozial, ökologisch und ethisch verantwortlich zu handeln – im Markt, am Arbeitsplatz, gegenüber der Umwelt und im Umgang mit Stakeholdern.
CSR ist ein Grundpfeiler nachhaltiger Unternehmensführung und Grundlage vieler Nachhaltigkeitsstrategien.
Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive ist ein EU-Gesetzesvorschlag (externer Link) zur Einführung verpflichtender menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten entlang globaler Wertschöpfungsketten. Die CSDDD verpflichtet Unternehmen, Risiken in ihrer Lieferkette aktiv zu identifizieren und zu minimieren – und erhöht die Relevanz nachhaltiger Beschaffung. Er ist eng mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verwandt, geht jedoch teilweise weiter.
Die Corporate Sustainability Reporting Directive ist eine EU-Richtlinie zur umfassenderen und verbindlicheren Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Sie löst die bisherige NFRD ab und weitet den Kreis berichtspflichtiger Unternehmen deutlich aus. Unter anderem werden die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) eingeführt, anhand derer Unternehmen detailliert über ihre ökologischen, sozialen und Governance-bezogenen Auswirkungen berichten müssen.
Die CSRD hat das Ziel, Transparenz, Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit von Nachhaltigkeitsinformationen im europäischen Wirtschaftsraum zu stärken, sodass Investoren, Stakeholder und die Öffentlichkeit fundierte Entscheidungen treffen können. Sie tritt schrittweise in Kraft, wobei zeitlich gestaffelte Übergangsfristen für verschiedene Unternehmensgrößen gelten sollen.
Weitere Informationen: Europäische Kommission zur CSRD (externer Link)
D
Degrowth ist ein Konzept, das auf eine bewusste Verringerung von Produktion und Konsum abzielt – mit dem Ziel, ökologische Stabilität, soziale Gerechtigkeit und Lebensqualität zu fördern. Statt auf Wirtschaftswachstum setzt Degrowth auf Gemeinwohlorientierung und suffiziente Lebensweisen.
Degrowth stellt das dominante Wachstumsparadigma infrage und regt zur Diskussion über alternative Wirtschaftsmodelle an.
Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist die Rahmenstrategie der Bundesregierung zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung in Deutschland. Sie definiert Ziele und Indikatoren zu Bereichen wie Klimaschutz, Ressourcenschonung und sozialer Gerechtigkeit. Die Strategie wurde erstmals 2002 verabschiedet und 2016 grundlegend überarbeitet.
Sie ist das zentrale Instrument zur Umsetzung der Agenda 2030 in Deutschland und wird regelmäßig durch einen politischen Fortschrittsbericht und einen Indikatorbericht überprüft.
Dekarbonisierung bezeichnet den systematischen Prozess zur Reduktion von CO2- und anderen Treibhausgasemissionen – etwa durch erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder Verzicht auf fossile Brennstoffe. Ziel ist das Erreichen von Netto-Null-Emissionen.
Dekarbonisierung ist ein zentraler Hebel zur Eindämmung des Klimawandels und zur langfristigen Erreichung internationaler Klimaziele und Netto-Null-Emissionen.
Diversity beschreibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten innerhalb einer Gesellschaft oder Belegschaft – etwa hinsichtlich Alter, Geschlecht, Herkunft, Fähigkeiten, sexueller Orientierung oder Religion.
Eine vielfältige Unternehmenskultur fördert Innovation, Teamleistung und gesellschaftliche Teilhabe. Unternehmne profitieren so oft von einer größeren Innovationskraft und einer breiteren Kundenansprache. Siehe auch Chancengerechtigkeit und Inklusion.
Die doppelte Wesentlichkeit (engl. „Double Materiality“) ist ein zentrales Konzept der Nachhaltigkeitsberichterstattung und wird u. a. in der CSRD gefordert. Sie betrachtet zwei Perspektiven:
- Inside-Out („Impact Materiality“): Welche Auswirkungen hat die Geschäftstätigkeit, die Lieferkette sowie die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Mensch und Umwelt?
- Outside-In („Financial Materiality“): Welche Risiken und Chancen ergeben sich aus Nachhaltigkeitsthemen für das Unternehmen selbst, beispielsweise hinsichtlich zukünftiger Marktanforderungen, Regulierungen oder Ressourcenverfügbarkeit?
Die kombinierte Betrachtung erlaubt es, sowohl die Beiträge und Verantwortung des Unternehmens gegenüber Umwelt und Gesellschaft als auch mögliche finanzielle Auswirkungen von Nachhaltigkeitsthemen (z. B. Klimawandel, Menschenrechte, Ressourcenkosten) zu bewerten. Die Ergebnisse werden typischerweise in einer Wesentlichkeitsanalyse erhoben und dienen als Grundlage für Strategie, Ziele und Maßnahmen eines umfassenden Nachhaltigkeitsmanagements.
Die doppelte Wesentlichkeit bildet die Grundlage für eine fundierte Wesentlichkeitsanalyse im Rahmen der CSRD.
E
Die Earth Hour ist eine weltweite Mitmachaktion, bei der Menschen, Städte und Unternehmen einmal im Jahr symbolisch für eine Stunde das Licht ausschalten, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Veranstaltet vom WWF (World Wide Fund For Nature, externer Link).
Die Earth Hour lenkt Aufmerksamkeit für den Ressourcenverbrauch, erzeugt politischen Druck und globale Sichtbarkeit für Klimaschutz und sensibilisiert für den Energieverbrauch im Alltag.
Der Earth Overshoot Day (dt.: Erdüberlastungstag) kennzeichnet den Tag im Jahr, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, die unser Planet in einem Jahr regenerieren kann. Jeder weitere Tag bedeutet ökologischen Überverbrauch, dass wir „auf Kredit“ von der Natur leben und künftigen Generationen Handlungsspielräume nehmen.
Der Erdüberlastungstag macht den Ressourcenverbrauch greifbar und visualisiert die Dringlichkeit ökologischer Veränderungen.
Das Emission Trading Scheme (ETS) ist ein marktbasiertes Instrument zur Begrenzung und Reduktion von Treibhausgasemissionen. Es legt eine Obergrenze (Cap) für Emissionen fest, innerhalb derer Unternehmen handelbare Emissionsrechte erwerben oder verkaufen können. Das EU-ETS (externer Link) ist das größte dieser Systeme.
Ein ETS schafft finanzielle Anreize zur Emissionsvermeidung dort, wo sie wirtschaftlich am effizientesten ist (siehe CO2-Handel).
Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen eingesetzter Energie und erzieltem Nutzen. Je weniger Energie benötigt wird, z. B. durch optimierte Prozesse, Gebäudeisolierung oder energiesparende Technologien, um eine bestimmte Leistung zu erbringen, desto höher ist die Effizienz.
Ziel ist, denselben Output mit geringerem Energieeinsatz zu erreichen. Energieeffizienz senkt somit Betriebskosten, schont Ressourcen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität.
Energieneutralität liegt vor, wenn eine Organisation oder Region ihren Energiebedarf vollständig aus erneuerbaren Quellen deckt oder diesen durch eigene Maßnahmen kompensiert.
Energieneutralität stärkt Unabhängigkeit und Resilienz gegenüber Energiemärkten und Energiepreisschwankungen und reduziert Treibhausgasemissionen.
Eine EU-Initiative (externer Link) zur Stärkung der Verbraucherrechte in der grünen Transformation. Ziel ist es, irreführende Umweltaussagen zu verhindern, Greenwashing zu reduzieren und fundierte Kaufentscheidungen durch bessere Produktinformationen zu ermöglichen.
Transparenz im Konsumverhalten ist entscheidend für die Marktakzeptanz nachhaltiger Produkte.
Energiequellen, die sich auf natürliche Weise erneuern und quasi unerschöpflich sind, – z. B. Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme und Biomasse.
Erneuerbare Energien tragen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei, sind zentral für eine klimafreundliche Energieversorgung und reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS, externer Link) sind einheitliche und verpflichtende EU-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen der CSRD. Sie definieren, welche Informationen Unternehmen zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen offenlegen müssen.
Die ESRS schaffen Transparenz und Vergleichbarkeit in der unternehmerischen Nachhaltigkeitsleistung und eine verlässliche, langfristige Datengrundlage für Investoren, Stakeholder und die Öffentlichkeit.
F
Fairer Handel (Fair Trade) beschreibt ein Handelskonzept, das ProduzentInnen in Ländern des Globalen Südens durch stabile Handelsbeziehungen und gerechte Preise, bessere Arbeitsbedingungen und langfristige Partnerschaften stärkt.
Ziel ist es, Benachteiligungen im Welthandel zu reduzieren und zur Existenzsicherung der ProduzentInnen.Fairer Handel trägt zur Armutsbekämpfung, Stärkung von Arbeitsrechten und nachhaltiger Entwicklung bei.
Bezeichnet alle für den menschlichen Verzehr produzierten Nahrungsmittel, die jedoch entlang der Lieferkette, im Handel oder beim Endverbrauch entsorgt werden.
Lebensmittelverschwendung belastet Ressourcen, erzeugt unnötige Emissionen (siehe CO2-Fußabdruck ) und verschärft globale Ungleichgewichte.
G
Gemeinwesen bezeichnet eine Gemeinschaft von Personen oder eine Gebietskörperschaft (z. B. Kommune), die durch gemeinsame Interessen, Werte oder rechtliche Rahmenbedingungen verbunden ist. Unternehmen wirken auf ihr Gemeinwesen ökonomisch, ökologisch und sozial ein.
Im Deutschen Nachhaltigkeitskodex wird das Gemeinwesen als relevanter Bezugspunkt genannt, wenn es um die Interaktion des Unternehmens mit seiner Umgebung geht.
Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein alternatives, ethisches Wirtschaftsmodell, das den unternehmerischen Erfolg nicht (nur) am finanziellen Gewinn, sondern am Beitrag zum Gemeinwohl misst. Bewertet werden Kriterien wie Menschenwürde, ökologische Nachhaltigkeit und Mitbestimmung – dokumentiert in einer Gemeinwohl-Bilanz.
Die Gemeinwohl-Ökonomie zeigt Wege auf, wie Wirtschaft sozial gerechter und ökologisch verträglicher gestaltet werden kann.
Gesetzeskonformes Verhalten bezeichnet die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften (Legalität), etwa im Bereich Arbeitsrecht, Umweltrecht, Datenschutz oder Antikorruption. Richtlinienkonformes Verhalten (Integrity) geht darüber hinaus und basiert auf freiwilligen Verhaltenskodizes (z. B. Code of Conduct).
Rechts- und regelkonformes Verhalten ist die Basis nachhaltiger Unternehmensführung und schützt vor Reputations- und Haftungsrisiken.
Das Greenhouse Gas Protocol ist ein global anerkannter Standard zur Erfassung und Bilanzierung von Treibhausgasemissionen. Entwickelt vom World Resources Institute (WRI, externer Link) und dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, externer Link). Es differenziert Emissionen nach Scope 1, 2 und 3.
Das GHG Protocol ist die Grundlage für viele Klimabilanzen und Berichtsstandards weltweit.
Der UN Global Compact ist eine freiwillige Unternehmensinitiative der Vereinten Nationen zur Förderung von zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Teilnehmende Unternehmen berichten jährlich über Fortschritte (Communication on Progress, CoP).
Der Global Compact ist das weltweit größte Unternehmensnetzwerk für nachhaltige Entwicklung. Kritiker bemängeln, dass die Anforderungen vergleichsweise gering sind und somit Greenwashing begünstigt werden könnte.
Weitere Informationen: Global Compact Netzwerk Deutschland (externer Link)
Die Global Reporting Initiative (GRI, externer Link) ist eine unabhängige Organisation, die internationale Standards (GRI-Standards) für Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt. Ziel ist die Verbesserung von Transparenz, Vergleichbarkeit und Glaubwürdigkeit unternehmerischer Nachhaltigkeitsberichte.
Die GRI-Standards sind weltweit verbreitet und gelten als Grundlage für viele freiwillige und regulatorische Berichte.
Die Green Claim Initiative (externer Link) ist eine EU-Initiative zur Regulierung von Umweltwerbung. Unternehmen sollen künftig verpflichtet werden, Umweltversprechen wie „klimaneutral“ oder „umweltfreundlich“ durch belastbare Nachweise zu belegen.
Die Initiative zielt auf mehr Transparenz im Markt und stärkt den Verbraucherschutz gegen Greenwashing.
Green Hushing ist eine Strategie, bei der Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele oder -fortschritte bewusst nicht oder nur eingeschränkt kommunizieren, um sich vor Kritik, Kontroversen oder Reputationsrisiken zu schützen.
Green Hushing untergräbt Transparenz, enthält Stakeholdern ein vollständiges Bild der Nachhaltigkeitsleistung vor und kann zu einem Vertrauensverlust führen.
Der Green New Deal (externer Link) ist ein politisches Konzept zur gleichzeitigen Förderung von ökologischer Transformation, wirtschaftlicher Innovation und sozialer Gerechtigkeit. Es setzt auf Investitionen in nachhaltige Infrastruktur, grüne Technologien und neue Arbeitsplätze.
Der Green New Deal ist ein möglicher Weg, Klima- und Wirtschaftspolitik miteinander zu verbinden – etwa in EU-Strategien wie dem European Green Deal.
Green Procurement bezeichnet die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien beim Einkauf von Produkten und Dienstleistungen. Dazu gehören etwa Umweltzertifikate, ressourcenschonende Herstellungsprozesse oder soziale Aspekte in ihren Lieferketten (siehe Sustainable Procurement).
Nachhaltige Beschaffung kann Umweltauswirkungen entlang der Lieferkette verringern und gesellschaftliche Verantwortung stärken. Siehe auch: Sustainable Procurement.
Greenwashing bezeichnet die Praxis, Umweltleistungen oder Nachhaltigkeitsengagement öffentlichkeitswirksam darzustellen, ohne dass diese Aussagen durch konkrete Maßnahmen oder überprüfbare Fakten gestützt werden.
Greenwashing untergräbt Glaubwürdigkeit, schadet dem Vertrauen von Stakeholdern und kann rechtliche Konsequenzen haben – insbesondere durch neue EU-Vorgaben wie die Green Claims Directive.
I
Die IFRS Sustainability Disclosure Standards sind Standardentwürfe des International Sustainability Standards Board (ISSB), die einheitliche Anforderungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung schaffen sollen. Sie beinhalten insbesondere die Standards IFRS S1 (allgemeine Nachhaltigkeitsangaben) und IFRS S2 (klimaspezifische Angaben).
Diese Standards zielen auf eine weltweit vergleichbare Offenlegung nicht-finanzieller Informationen – mit Fokus auf die Bedürfnisse von Investoren.
Die International Labour Organization ist eineSonderorganisation der Vereinten Nationen, die sich weltweit für faire, sichere und menschenwürdige Arbeitsbedingungen einsetzt. Sie definiert internationale Arbeits- und Sozialstandards zu Themen wie Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Gleichbehandlung und Vereinigungsfreiheit.
ILO-Standards sind zentrale Bezugspunkte für nachhaltige Lieferketten, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten und soziale Verantwortung von Unternehmen.
Impact Investing ist eine Kapitalanlageform, bei der neben finanziellen Erträgen auch positive soziale und ökologische Wirkungen angestrebt werden. Investitionen erfolgen gezielt in Projekte oder Unternehmen mit messbarem Nachhaltigkeitsbeitrag.
Impact Investing verbindet Rendite mit Verantwortung und ermöglicht die Finanzierung nachhaltiger Innovationen und Geschäftsmodelle.
Inklusion bezeichnet die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an Gesellschaft und Arbeitswelt – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Behinderung, Alter oder sozialem Status. Inklusive Organisationen schaffen ein Arbeitsumfeld, das Vielfalt anerkennt und aktiv einbezieht.
Inklusion fördert Chancengerechtigkeit, stärkt die Unternehmenskultur und steigert Innovationskraft. Siehe auch: Charta der Vielfalt.
Innovationen sind Neuerungen bei Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen, die zu ökologischen, sozialen oder ökonomischen Verbesserungen führen können. Im Nachhaltigkeitskontext bedeutet Innovation z. B. ressourcenschonende Produktentwicklung oder inklusivere Organisationsformen.
Innovationen sind zentrale Treiber nachhaltiger Entwicklung und helfen, zukunftsfähige Lösungen für komplexe Herausforderungen zu entwickeln.
Die International Sustainability Standards Boards sind ein Gremium der IFRS Foundation zur Entwicklung globaler Offenlegungsstandards für Nachhaltigkeitsinformationen. Es wurde gegründet, um Fragmentierung zu vermeiden und die Qualität, Konsistenz und Vergleichbarkeit von Berichten zu verbessern.
Das ISSB soll ein international einheitliches Fundament für nachhaltigkeitsbezogene Finanzinformationen schaffen.
Internationale Norm für Umweltmanagementsysteme. Sie hilft Unternehmen, Umweltbelastungen systematisch zu erkennen, zu reduzieren und langfristig ihre Umweltleistung zu verbessern. Zertifizierungen gelten in der Regel für drei Jahre.
ISO 14001 fördert strukturierten Umweltschutz im Unternehmen und ist vielfach Voraussetzung in Ausschreibungen und Lieferketten.
Internationale Leitlinie für nachhaltige Beschaffung. Sie unterstützt Organisationen dabei, ökologische und soziale Kriterien in Einkaufsprozesse zu integrieren – etwa durch Risikobewertung, Lieferantenauswahl und Zusammenarbeit (siehe Sustainable Procurement).
ISO 20400 schafft Orientierung für nachhaltige Beschaffungsstrategien und ergänzt Standards wie ISO 14001 oder ISO 26000.
Freiwillige Leitlinie zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen. Sie beschreibt Grundsätze, Handlungsfelder und Empfehlungen zu Themen wie Menschenrechte, Umwelt, Arbeitspraktiken und fairer Geschäftsbetrieb.
ISO 26000 ist kein zertifizierbarer Standard, aber ein international anerkanntes Orientierungsinstrument für verantwortungsvolles Handeln.
Internationale Norm für Energiemanagementsysteme. Sie hilft Unternehmen, ihre Energieverbräuche zu analysieren, Einsparpotenziale zu identifizieren und ihre Energieeffizienz zu steigern.
ISO 50001 unterstützt die Reduktion von Emissionen und Betriebskosten durch systematisches Energiemanagement.
Normenfamilie für Qualitätsmanagement, die Grundprinzipien wie Kundenorientierung, Führungsverantwortung und kontinuierliche Verbesserung definiert. Sie bietet eine Basis für strukturiertes Management und lässt sich mit Nachhaltigkeitszielen verknüpfen.
Die ISO 9000-Reihe schafft Vertrauen in Prozesse und Produkte – auch im Kontext nachhaltiger Wertschöpfung.
Zertifizierbarer Standard innerhalb der ISO 9000-Reihe. Er legt konkrete Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme fest – u. a. zur Prozessoptimierung, Kundenbindung und Fehlervermeidung.
ISO 9001 kann zur Umsetzung ausgewählter SDGs beitragen, etwa in den Bereichen verantwortungsvoller Konsum, Innovation und Bildung.
K
Klimaanpassung (engl.: Climate Adaptation) bezeichnet Maßnahmen zur Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels – z. B. Schutzbauten gegen Hochwasser, hitzeresistente Gebäude oder angepasstes Wassermanagement. Auch Unternehmen entwickeln zunehmend Klimarisikoanalysen.
Klimaanpassung stärkt die Resilienz gegenüber Klimarisiken und ist ein zentraler Baustein ganzheitlicher, auch ökonomischer, Klimastrategien.
Die Klimabilanz erfasst alle Treibhausgasemissionen, die durch Aktivitäten einer Organisation, eines Produkts oder einer Person verursacht werden. Sie dient als Basis für die Entwicklung wirksamer Reduktionsmaßnahmen (z. B. Corporate Carbon Footprint).
Eine Klimabilanz ist oft Voraussetzung für regulatorische Anforderungen (z. B. CSRD) und glaubwürdige Klimastrategien.
→ Siehe: Carbon Neutral / Klimaneutralität
Eine Klimastrategie fasst Ziele und Maßnahmen zur systematischen Reduktion von Treibhausgasemissionen zusammen. Sie stützt sich in der Regel auf eine Klimabilanz und berücksichtigt u. a. Energieeffizienz, erneuerbare Energien und langfristige Netto-Null-Ziele (Net Zero).
Eine fundierte Klimastrategie hilft, regulatorische Risiken zu managen und ökologische Verantwortung zu übernehmen.
Die Klimatransformation bezeichnet den umfassenden Wandel hin zu einer klimaverträglichen Wirtschafts- und Lebensweise. Unternehmen verändern ihre Prozesse, Produkte und Strategien – etwa durch CO2-arme Technologien, Dekarbonisierung der Lieferkette oder Nutzung erneuerbarer Energien.
Eine Klimatransformation ist essenziell, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
Klimawandel bezeichnet langfristige Veränderungen des globalen Klimas – insbesondere die menschengemachte Erderwärmung durch Treibhausgase. Folgen sind Extremwetter, steigende Meeresspiegel und Verschiebungen in Ökosystemen.
Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft dar.
Das Kyoto-Protokoll ist ein internationales Klimaabkommen von 1997, das Industrieländer erstmals rechtlich zur Reduktion von Treibhausgasemissionen verpflichtete. Es führte unter anderem zum Clean Development Mechanism (CDM) und zum Emissionshandelssystem (ETS).
Das Kyoto-Protokoll war ein Meilenstein der internationalen Klimapolitik – mit direkten Auswirkungen auf heutige Instrumente wie CO2-Zertifikate.
→ Siehe: Circular Economy
L
→ Siehe: Life Cycle Assessment (LCA)
Deutsches Gesetz zur Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten in globalen Lieferketten. Es gilt seit 2023 für große Unternehmen und soll künftig auf kleinere ausgeweitet werden.
Das LkSG verpflichtet Unternehmen zu Risikoanalysen, Präventionsmaßnahmen und Berichterstattung – mit möglichen Sanktionen bei Verstößen.
Lobbylisten sind Verzeichnisse, in denen sich Interessenvertretungen auf freiwilliger Basis registrieren können – z. B. beim Deutschen Bundestag oder der EU-Kommission. Im Unterschied zu Lobbyregistern sind Angaben zu Budgets oder Ansprechpartnern nicht verpflichtend.
Lobbylisten bieten begrenzte Transparenz zu politischen Einflussnahmen – ein vollständigeres Bild liefern verpflichtende Register.
Ein öffentlich einsehbares Register, in dem Interessenvertretungen verpflichtet sind, Informationen zu ihrer Lobbyarbeit offen zu legen – etwa Zielsetzungen, AnsprechpartnerInnen, finanzielle Aufwendungen und adressierte politische Ebenen. In Deutschland wurde das Lobbyregistergesetz 2022 eingeführt; auf EU-Ebene besteht ein vergleichbares Register für EU-Institutionen.
Lobbyregister erhöhen die Transparenz politischer Einflussnahme und sind ein Instrument zur Stärkung demokratischer Kontrolle – insbesondere bei Nachhaltigkeitsthemen mit hohem öffentlichem Interesse (z. B. Klimapolitik, Lieferkettengesetz, CO2-Handel).
M
Da es kein einheitliches, voll integriertes Nachhaltigkeitsmanagementsystem gibt, greifen Unternehmen häufig auf spezialisierte Systeme zurück, die Teilaspekte abdecken. Beispiele sind EMAS, ISO 14001 (Umweltmanagement), ISO 9001 (Qualitätsmanagement), SA 8000 (Arbeitsbedingungen) oder IDW PS 980 (Prüfung von Compliance-Managementsystemen). Unternehmen können diese Systeme kombinieren oder ergänzen, um ein umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement zu etablieren.
Oft synonym zum Begriff Wesentlichkeitsanalyse verwendet. Dient der Ermittlung der für ein Unternehmen und seine Stakeholder relevanten Nachhaltigkeitsthemen. Siehe Doppelte Wesentlichkeit.
Menschenrechte gelten für alle Menschen universell und unteilbar. Staaten und Unternehmen haben die Pflicht, ihre Einhaltung zu respektieren und zu fördern. Im Unternehmenskontext sind u. a. die ILO-Kernarbeitsnormen oder die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wegweisend. Zentrale Themen sind u. a. keine Diskriminierung, angemessene Arbeitsbedingungen, keine Zwangs- oder Kinderarbeit.
N
2016 vom Bundeskabinett verabschiedet, um die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte umzusetzen. Ziel ist die Verbesserung der menschenrechtlichen Lage entlang globaler Lieferketten. Verschiedene Bundesministerien sind beteiligt, federführend ist das Auswärtige Amt. Weitere Informationen finden sich u. a. beim Helpdesk NAP (externer Link).
Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu decken. Es schließt eine langfristige Perspektive ein, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Ziel ist eine Balance, die planetare Grenzen respektiert und soziale Gerechtigkeit fördert.
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung umfasst die systematische Offenlegung von Informationen über ökologische, soziale und ökonomische Auswirkungen und Leistungen eines Unternehmens. Sie zeigt, wie verantwortungsvoll eine Organisation mit Ressourcen umgeht, wie sie soziale Belange adressiert oder Governance-Strukturen aufstellt. Siehe auch CSRD und ESRS.
Beschreibt die Integration ökologischer, sozialer und ökonomischer Kriterien in die Leitung eines Unternehmens. Ziel ist, diese Dimensionen konsequent in strategische und operative Entscheidungen einzubeziehen. In der Praxis baut Nachhaltigkeitsmanagement meist auf bestehenden Systemen (z. B. Qualitäts- oder Umweltmanagement) auf und führt sie zu einem ganzheitlichen Ansatz zusammen.
Bestätigen, dass bestimmte Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen definierte Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Bekannte Beispiele sind Bio-Siegel für Lebensmittel oder Fair-Trade-Zertifizierungen. Sie erleichtern Verbraucherinnen und Verbrauchern die Entscheidung für nachhaltigere Alternativen und schaffen Transparenz über bestimmte ökologische oder soziale Kriterien.
Ein Zustand, in dem die gesamten menschengemachten Treibhausgasemissionen durch entsprechende Senken (z. B. Aufforstung, Technologie zur CO2-Entnahme) vollständig ausgeglichen werden. Zunächst sollten Emissionen so weit wie möglich vermieden oder reduziert werden (Carbon Insetting), bevor unvermeidbare Restemissionen durch Carbon Offsetting kompensiert werden.
Die bisherige EU-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung großer kapitalmarktorientierter Unternehmen, die durch die CSRD abgelöst bzw. erweitert wird.
Siehe Net Zero.
O
Die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) richten sich an multinationale Unternehmen und definieren Prinzipien für verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften. Sie wurden zuletzt 2011 überarbeitet und umfassen u. a. Umwelt- und Sozialstandards, Achtung der Menschenrechte sowie Transparenz- und Offenlegungsverpflichtungen. Sie sind zwar nicht rechtsverbindlich, doch haben sich die Regierungen der OECD-Mitgliedsstaaten verpflichtet, deren Umsetzung aktiv zu unterstützen.
Mehr Informationen: OECD-Leitsätze (externer Link)
Ö
Analysiert das Verhältnis zwischen Zielerreichung (möglichst geringe Umweltbelastung) und eingesetzten Mitteln (Finanzen, Ressourcen). Sie baut auf Konzepten wie dem Lebenszyklusanalyse-Ansatz auf, berücksichtigt jedoch zusätzlich Kostenaspekte. Ziel ist es, die ökologisch und ökonomisch beste Option zu identifizieren.
Gibt Auskunft über die Fläche auf der Erde, die benötigt wird, um den Lebensstil eines Menschen oder Unternehmens zu unterstützen (Produktion, Entsorgung, CO2-Bindung etc.). Oft wird dieser Wert in globalen Hektar pro Person angegeben. Im Gegensatz dazu betrachtet der Ökologische Handabdruck die positiven Beiträge eines Akteurs.
Ergänzt den ökologischen Fußabdruck, indem er die positiven Beiträge eines Akteurs in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehören Maßnahmen, die aktiv Ressourcen schonen, Emissionen verringern und nachhaltige Entwicklung fördern.
Leistungen intakter Ökosysteme, von denen der Mensch profitiert, wie Bestäubung, Bodenfruchtbarkeit, Wasseraufbereitung oder Klimaregulierung. Sie sind die Grundlage vieler wirtschaftlicher Aktivitäten, werden jedoch häufig nicht ausreichend in betriebliche Kalkulationen einbezogen.
Siehe Ökosystemdienstleistungen.
Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen (z. B. Sonne, Wind, Wasser, Biomasse) gewonnen wird. Ökostrom trägt zur Reduzierung direkter Treibhausgasemissionen bei und fördert den Ausbau klimafreundlicher Infrastruktur.
P
Ein völkerrechtlich verbindliches Klimaabkommen, das im Dezember 2015 auf der UN-Klimakonferenz in Paris beschlossen wurde. Ziel ist, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen und Anstrengungen zur Begrenzung auf 1,5 °C zu unternehmen. Alle Vertragsstaaten müssen eigene Klimaschutzbeiträge (NDCs) festlegen und regelmäßig berichten.
Das Pariser Klimaziel strebt an, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C – möglichst 1,5 °C – über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dazu haben sich die Vertragsstaaten des Pariser Abkommens verpflichtet. Um dieses Ziel zu erreichen, sind drastische CO2-Reduktionen und eine umfassende Dekarbonisierung der Wirtschaft nötig.
Beinhaltet alle direkten und indirekten Aktivitäten eines Unternehmens, um politische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen – etwa durch Lobbying, Parteispenden oder die Beteiligung an Interessensverbänden. Transparenz darüber ist im Nachhaltigkeitskontext wichtig, da intransparente Einflussnahme gesellschaftliches Vertrauen untergraben kann (siehe auch Lobbylisten).
(Deutsch: „Produktbezogene CO2-Bilanz“)
Misst den gesamten Treibhausgasausstoß über den Lebenszyklus eines einzelnen Produkts hinweg – von der Rohstoffgewinnung über Produktion und Distribution bis hin zur Nutzung und Entsorgung. Er ermöglicht es, gezielt Maßnahmen zur CO2-Reduktion entlang der Produktkette zu identifizieren und umzusetzen.
Umfasst alle Phasen eines Produkts von der Entwicklung über die Markteinführung bis zur Herausnahme aus dem Markt. Unter Nachhaltigkeitsaspekten wird dabei der gesamte Lebensweg betrachtet, einschließlich Design, Rohstoffe, Herstellung, Transport, Nutzung und Verwertung (siehe Lebenszyklusanalyse).
(Deutsch: „Lebenszyklusanalyse“)
Ein methodischer Ansatz zur Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Dabei werden Rohstoffgewinnung, Produktion, Transport, Nutzung und Entsorgung berücksichtigt. LCA ist oft Grundlage für Produktoptimierungen, die Ressourceneinsatz und Emissionen reduzieren sollen.
R
Beschreibt die Vermarktung oder symbolische Unterstützung von LGBTQI+-Themen (z. B. Regenbogenfarben im Firmenlogo) ohne echtes Engagement oder ernsthafte Förderung der Rechte dieser Gemeinschaften. Oft wird der Anschein von Toleranz erweckt, während intern oder bei Geschäftspraktiken keine entsprechende Sensibilität oder konkrete Maßnahmen vorliegen.
Umfasst sowohl materielle als auch immaterielle Mittel, die in Prozessen genutzt werden (z. B. Rohstoffe, Energie, Kapital, Personal, Zeit) sowie die Vorteile intakter Ökosysteme. Nachhaltiges Ressourcenmanagement zielt auf einen schonenden und effizienten Einsatz ab.
Bezeichnet die möglichst sparsame und effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen. Unternehmen setzen hier auf Strategien wie Recycling, Wiederverwendung und optimierte Produktionsprozesse, um Umweltbelastungen zu minimieren und Kosten zu senken.
Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems (z. B. eines Unternehmens oder einer Gesellschaft), sich an Veränderungen oder Krisen anzupassen und sich davon zu erholen, ohne die grundlegenden Strukturen oder Funktionen zu verlieren. Im Nachhaltigkeitskontext bedeutet das, Strategien zur Risikominimierung (z. B. Klimarisiken) zu entwickeln und sich resilient gegenüber Markt-, Umwelt- und sozialen Umbrüchen zu positionieren.
Ereignisse, die potenziell negative Auswirkungen auf ein Unternehmen, seine Stakeholder oder die Umwelt haben. Im Nachhaltigkeitskontext geht es um Risiken, die aus sozialen, ökologischen oder Governance-Aspekten entstehen können. Nach dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz sind Unternehmen aufgefordert, wesentliche Risiken offenzulegen, die mit ihrer Geschäftstätigkeit, ihren Produkten oder Dienstleistungen zusammenhängen.
Organisationen, die wie klassische Unternehmen wirtschaften, aber primär einen gesellschaftlichen oder ökologischen Zweck verfolgen. Gewinne werden zumeist reinvestiert, um das soziale Ziel weiter voranzutreiben. Sozialunternehmen handeln oft ganzheitlich, indem sie sowohl auf ökologische Aspekte als auch auf faire Arbeitsbedingungen achten.
S
Ein internationaler Standard, der Mindestanforderungen an die Arbeitsbedingungen festlegt (zum Beispiel Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit). Unternehmen können sich freiwillig nach SA 8000 zertifizieren lassen, um ihre soziale Verantwortung zu unterstreichen.
Ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen (u. a. CDP, UN Global Compact, WWF), der Unternehmen bei der Festlegung wissenschaftsbasierter Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen unterstützt. Diese Ziele sind an das 1,5-°C- bzw. 2-°C-Klimaziel des Pariser Abkommens gekoppelt.
Drei Emissionsbereiche, die im GHG Protocol definiert werden:
- Scope 1: Direkte Emissionen aus unternehmenseigenen Quellen.
- Scope 2: Indirekte Emissionen durch eingekaufte Energie (Strom, Wärme, Kälte).
- Scope 3: Alle weiteren indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette (z. B. Vorprodukte, Transport, Entsorgung, Geschäftsreisen).
Personen oder Gruppen, die von den Aktivitäten eines Unternehmens betroffen sind oder ein berechtigtes Interesse daran haben (z. B. Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten, NGOs, Behörden). Siehe auch Stakeholder-Dialoge.
Systematische Prozesse, um Stakeholder in die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie einzubeziehen. Dies kann in Form von Workshops, Befragungen oder Diskussionsrunden geschehen und hilft dabei, Erwartungen und Bedenken frühzeitig zu erkennen.
Im Nachhaltigkeitskontext das Ersetzen umweltschädlicher oder ressourcenintensiver Materialien und Prozesse durch umweltfreundlichere Alternativen, um negative Umweltauswirkungen zu reduzieren.
Ein Prinzip, das auf die Reduktion des Verbrauchs und die Bewusstseinsänderung hin zu weniger Ressourcen- und Energieeinsatz abzielt. Suffizienz ergänzt Effizienz und Konsistenz um die Idee, nicht nur besser, sondern auch weniger zu konsumieren.
Umfasst alle Prozesse und Akteure, die ein Produkt oder eine Dienstleistung von der Rohstoffgewinnung bis zum Endkunden (und der möglichen Entsorgung) durchläuft. Nachhaltige Lieferketten berücksichtigen soziale, ökologische und ökonomische Kriterien gleichermaßen.
Eine Erweiterung der klassischen Balanced Scorecard, die neben finanziellen, kunden- und prozessorientierten Kennzahlen auch Nachhaltigkeitsaspekte integriert. Ziel ist eine ganzheitliche Steuerung des Unternehmens in wirtschaftlicher und ökologisch-sozialer Hinsicht.
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (beschlossen 2015), die bis 2030 erreicht werden sollen. Sie adressieren globale Herausforderungen wie Armut, Bildung, Gesundheit, Geschlechtergerechtigkeit, saubere Energie und Klimaschutz. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen SDG-Seite der Vereinten Nationen: SDGs (externer Link).
Eine EU-Verordnung, die Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater verpflichtet, offenzulegen, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen berücksichtigen und welche nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen ihre Finanzprodukte haben. Ziel ist es, Transparenz und Vergleichbarkeit im Bereich nachhaltiger Finanzprodukte zu erhöhen.
Setzt auf den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen, die während ihres gesamten Lebenszyklus möglichst umwelt- und sozialverträglich sind. Lieferanten werden nach ökologischen und sozialen Kriterien ausgewählt und langfristige Beziehungen gepflegt (siehe ISO 20400).
Ein Instrument, um die ökonomischen Effekte eines Unternehmens (z. B. Wertsteigerung) zu berechnen, indem die ökologischen und sozialen Lasten einbezogen werden. Ziel ist, den tatsächlichen Mehrwert oder Schaden abzubilden, den die Geschäftstätigkeit in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft verursacht.
Steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken). Die SWOT-Analyse betrachtet interne und externe Faktoren und kann auch im Nachhaltigkeitskontext (z. B. zur Bewertung von ESG-Risiken) eingesetzt werden.
T
Ein physikalisches Phänomen, bei dem Gase (z. B. Wasserdampf, CO2) in der Erdatmosphäre Wärmestrahlung zurückhalten. Der natürliche Treibhauseffekt hält die Erde bewohnbar. Der anthropogene (menschlich verursachte) Treibhauseffekt entsteht durch zusätzliche Emissionen und verstärkt die Erderwärmung.
Gase wie CO2, Methan (CH4) und Lachgas (N2O), die zum Treibhauseffekt beitragen. Ihre Freisetzung führt zur Erderwärmung und zum Klimawandel. Hauptverursacher sind Verkehr, Energieerzeugung, Industrie und Landwirtschaft.
Ein Konzept, das Nachhaltigkeit in drei Dimensionen betrachtet: Ökonomie, Ökologie und Soziales. Unternehmen sollen ihre Leistungen nicht nur nach finanziellen Kennzahlen („Profit“), sondern auch nach ihrem Beitrag zum Planeten („Planet“) und zu den Menschen („People“) bewerten.
U
Eine freiwillige Initiative der Vereinten Nationen, bei der sich Unternehmen zu zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung bekennen. Der jährliche Fortschrittsbericht (CoP) dient der Überprüfung der Zielerreichung.
Auch „Ruggie-Prinzipien“ genannt, 2011 verabschiedet. Sie verpflichten Staaten und Unternehmen, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten zu wahren und negative Auswirkungen auf Menschenrechte zu erkennen, abzuwenden oder zu beheben. Dazu gehören auch entsprechende Beschwerdemechanismen.
Direkte oder indirekte Effekte, die menschliche Aktivitäten auf die Umwelt haben. Dazu zählen Ressourcenverbrauch (Wasser, Energie, Rohstoffe), Emissionen (z. B. Treibhausgase, Schadstoffe) oder Eingriffe in Ökosysteme. Unternehmen sollten ihre Umweltauswirkungen erfassen und managen, um negative Effekte zu minimieren.
Produkte, die unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien entwickelt und hergestellt wurden und geringe negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Dies kann bspw. bedeuten, dass nachhaltige Materialien verwendet, Schadstoffe vermieden oder die Energieeffizienz erhöht wird.
Umfasst Maßnahmen und Strategien, die zum Erhalt und zur Verbesserung von natürlichen Lebensgrundlagen beitragen. Im Unternehmenskontext kann dies z. B. das Einführen von Umweltmanagementsystemen, die Verringerung von Abfällen oder den Einsatz emissionsarmer Technologien beinhalten.
Bezeichnet die Aufwertung von scheinbar unbrauchbaren oder alten Materialien, indem sie in Produkte höherer Qualität oder Funktionalität umgewandelt werden. Beispiele sind Modeartikel aus Reststoffen oder Möbel aus Paletten.
Ein US-amerikanisches Gesetz, das den Import von Waren aus Xinjiang (China) einschränkt, wenn die Vermutung besteht, dass Zwangsarbeit eingesetzt wurde. Unternehmen müssen nachweisen, dass ihre Lieferkette frei von Menschenrechtsverletzungen ist. Zusammen mit EU-Initiativen gegen Zwangsarbeit soll es die menschenrechtliche Verantwortung globaler Lieferketten stärken.
V
Umfasst alle Aktivitäten und Akteure, die Werte in Form von Produkten oder Dienstleistungen schaffen oder empfangen. Darunter fallen auch Recycling und Entsorgung, während sich der Begriff Lieferkette oft auf den engeren Bereich bis zur Auslieferung fokussiert.
(Engl. Responsible Investments)
Berücksichtigen soziale, ökologische und ethische Kriterien bei Anlageentscheidungen. Ziel ist es, durch Investitionen positive Veränderungen zu fördern oder zumindest negative Auswirkungen (z. B. auf Umwelt und Gesellschaft) zu vermeiden. Beispiele sind nachhaltige Fonds oder Impact-Investments.
Vom Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e. V. (VfU) entwickelte Kennzahlen, um betriebliche Umweltwirkungen im Finanzsektor zu bilanzieren. Sie sind an internationale Standards wie GRI oder das GHG Protocol angelehnt und werden regelmäßig aktualisiert.
W
Ein Grundsatz aus der Rechnungslegung, der im Nachhaltigkeitskontext auf relevante Themen ausgeweitet wird, die erhebliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben oder die Entscheidungsfindung von Stakeholdern beeinflussen (siehe Doppelte Wesentlichkeit). Die CSRD führt mit der doppelten Wesentlichkeit (Inside-Out und Outside-In) eine erweiterte Perspektive ein.
Bezeichnet das gezielte Hervorheben ethischer oder korrekter Verhaltensweisen, um fragwürdige Praktiken zu verschleiern oder sich eine weiße Weste zu geben. Während beim Greenwashing die ökologische Seite im Fokus steht, betrifft Whitewashing vor allem politische und soziale Engagements, die zwar dargestellt, aber nicht wirklich gelebt werden.
Z
Ein Lebens- und Wirtschaftsstil, der versucht, Abfälle vollständig zu vermeiden bzw. sämtliche Materialien zu verwerten. Ziel ist die Schließung von Stoffkreisläufen und die Reduktion von Deponie- und Verbrennungsabfällen (siehe Kreislaufwirtschaft).
Eine Form von Menschenrechtsverletzung, bei der Menschen gegen ihren Willen und unter Androhung von Strafen zur Arbeit gezwungen werden. In globalen Lieferketten kann Zwangsarbeit in Zulieferbetrieben auftreten. Internationale Bemühungen wie die ILO-Kernarbeitsnormen, das LkSG oder UFLPA sollen Unternehmen verpflichten, Zwangsarbeit zu unterbinden.
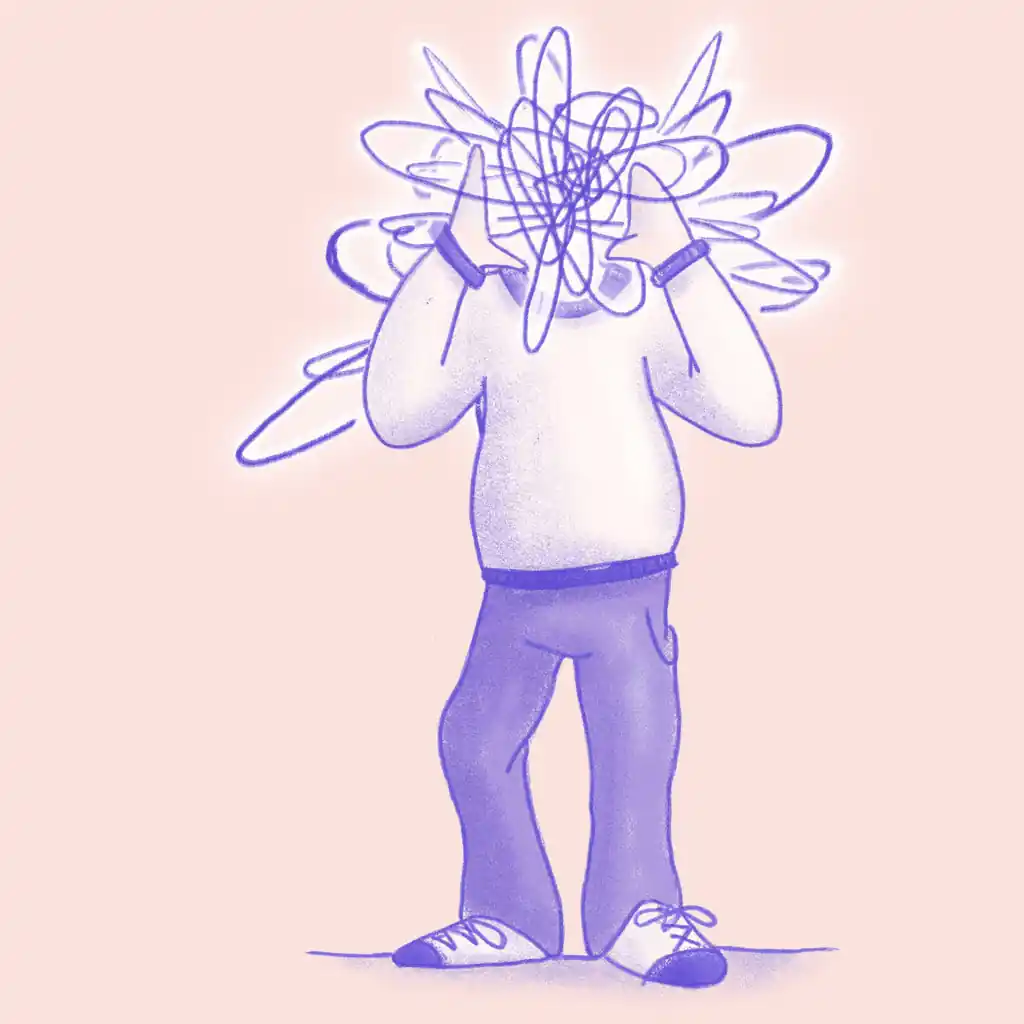
Wenn Sie Fragen haben, freue ich mich auf Ihre Nachricht!

Bezeichnet die sozialen Auswirkungen einer Organisation, eines Produkts oder einer Dienstleistung. Dazu gehören Arbeitsbedingungen, Menschenrechtsfragen, faire Löhne und Diversity-Aspekte. Eine Analyse des Social Footprint ergänzt den ökologischen Fußabdruck um soziale Kriterien.